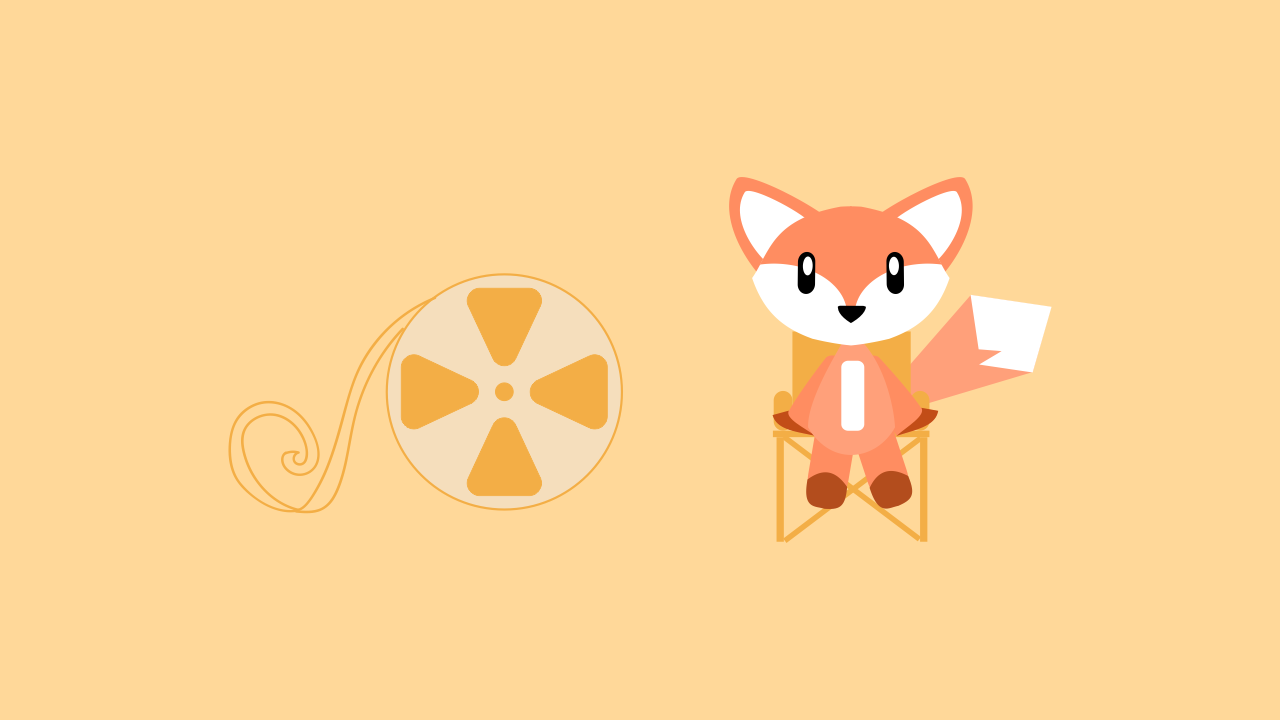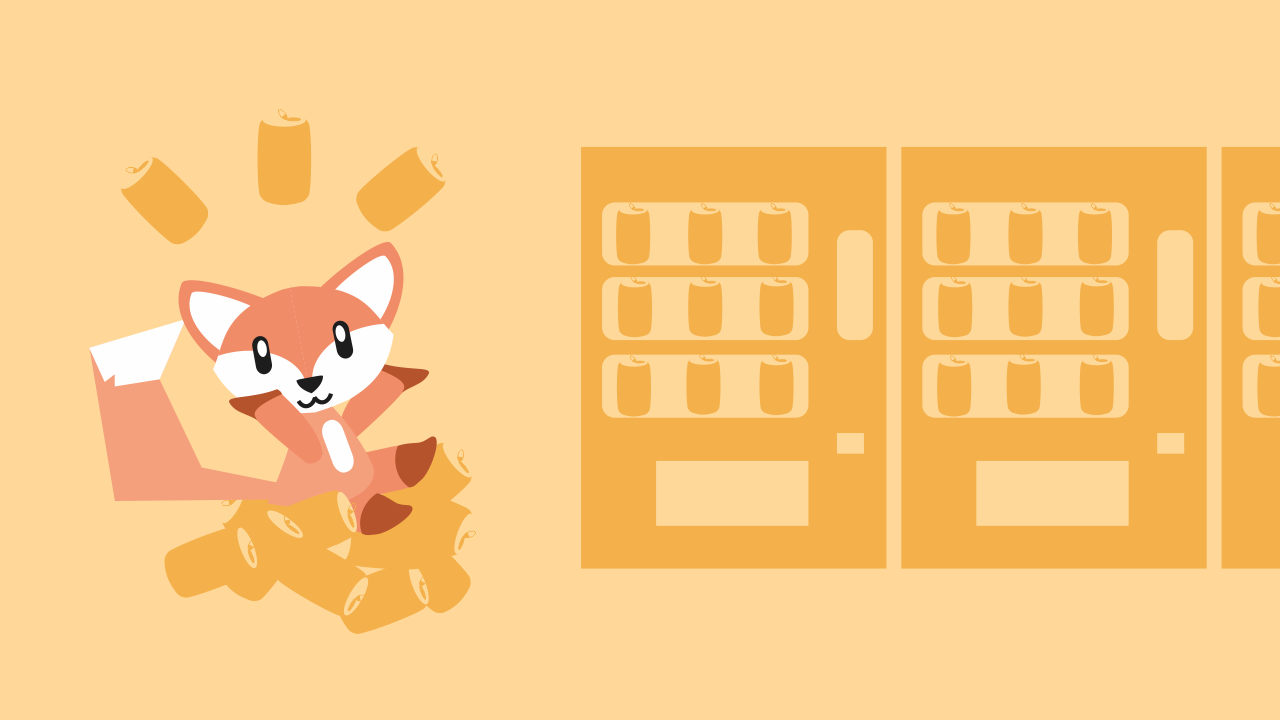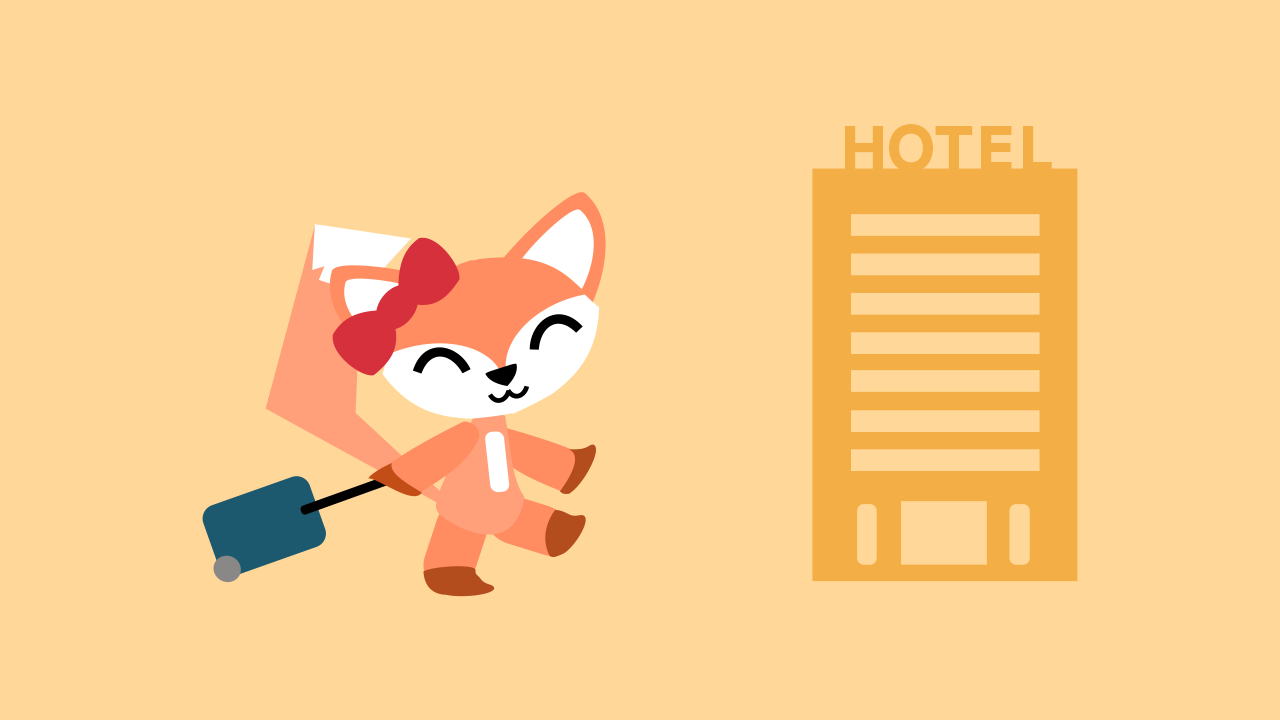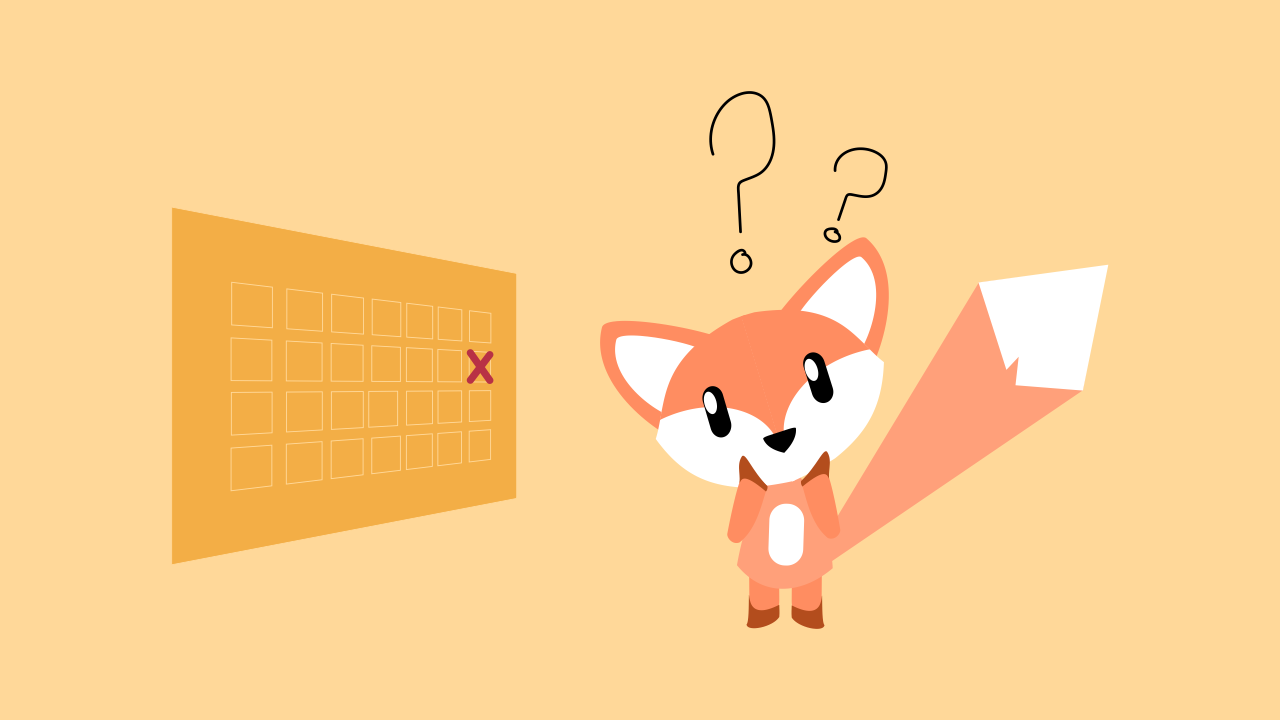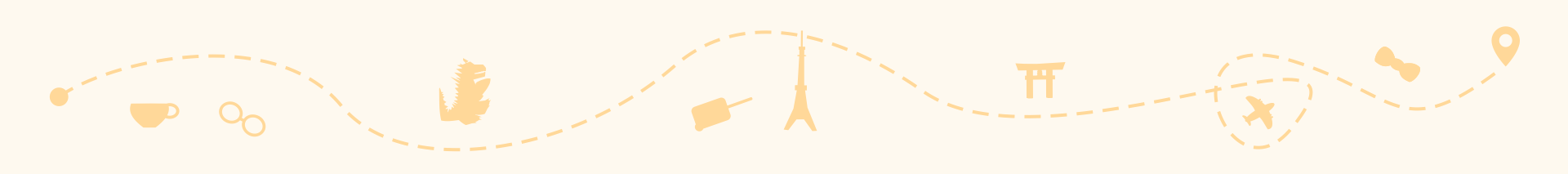Portale, die sich niemals schließen
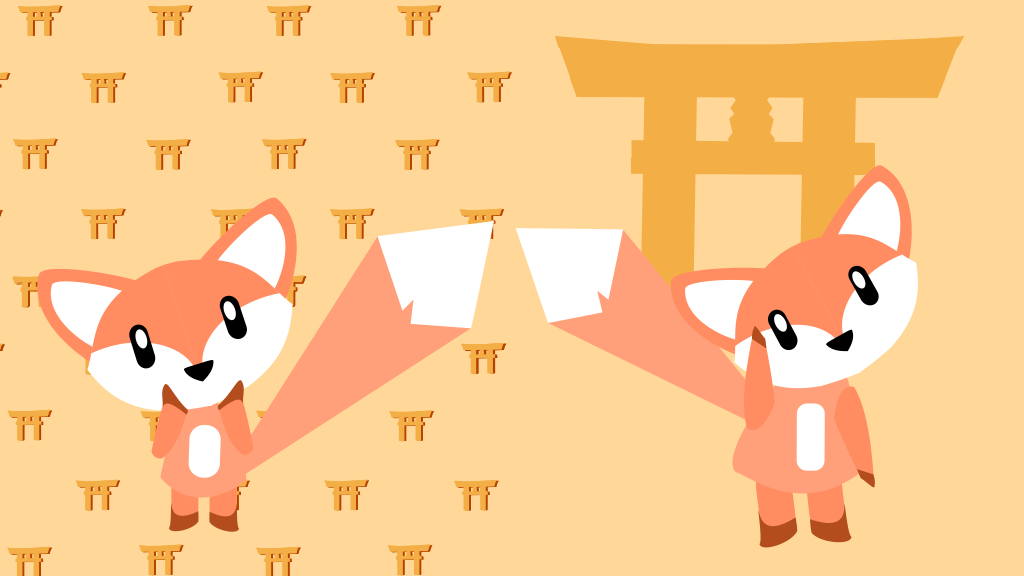
Es kann auf den ersten Blick schon ein wenig amüsieren: Da steht, mitten im Gelände, eine rot angestrichene Holzkonstruktion, die mit einiger unbedarfter Fantasie als Portal oder Tor erscheinen kann. Doch weder lassen sich irgendwo Flügel oder Gitter erkennen, mit denen sich das Portal verschließen ließe. Noch findet sich ein Zaun oder eine Mauer, in die das Tor eine Öffnung schlägt. Das Torii, so nennt sich das Bauwerk aus Querbalken auf zwei Säulen, steht, so der oberflächliche Eindruck, auf verlassenem Posten.

Das Torii zum Itsukushima Schrein auf der Insel Miyajima
Schlicht, aber mystisch
Wir Bewohner Europas kennen vor allem wehrhafte Stadttore oder monumentale Kirchenportale. Ich selbst habe sowohl die heiligen Pforten des Vatikan in Rom durchschritten als auch die Porta Nigra in Trier. Auch Triumphtore am Ende von Prachtstraßen, etwa das Brandenburger Tor, oder Denkmäler wie das Arc de Triomphe in Paris, zählen zu unserem postkartenträchtigen Kulturerbe. Sie alle eint die Absicht, die ganze Glorie ihrer Erbauer oder ihres Zwecks zu verkörpern — und ewig zu bestehen. Das verraten schon die Steine als Baumaterial. Das japanische Torii dagegen, ganz aus Holz gefertigt, übt sich in Schlichtheit und strahlt doch mystische Würde aus.
Was ich erst durch Recherche lerne: Jedes Torii markiert tatsächlich den Zugang zu einem heiligen Bereich, nämlich zu einem Shinto-Schrein. Dieser Religion gehören je nach Quelle zwischen 50 und 80 Prozent der japanischen Bevölkerung an. Der Shinto lehrt die Anwesenheit von Gottheiten, so genannten ›Kami‹. mitten unter den Menschen. Ihren Wohnsitz nehmen die Kami in Schreinen, also von Menschen errichteten und geschmückten Bauwerken. Sie lassen sich ganz entfernt sicherlich mit den kleinen Kapellen am Wegesrand vergleichen, die wir hierzulande vor allem in religiösen Gegenden antreffen, beispielsweise in Bayern, Rheinland-Pfalz oder Thüringen.
Du betrittst heiligen Boden
Viele Torii fallen durch einen roten Anstrich auf. Der macht sie nicht nur zu einem sehr attraktiven Fotomotiv. Die Farbe Rot übernimmt auch eine Aufgabe: Sie soll Dämonen abzuwehren helfen, denn genauso wie für Krankheit und Besessenheit steht die Farbe auch für den Schutz vor bösen Geistern, Gefahren und Pech. Möglicherweise soll der Anstrich das nicht ewig haltbare Holz des Torii außerdem vor Verwitterung bewahren — womit die Farbe Rot abermals ihre schützenden Wirkung beweist.
Auf eine andere Weise beeindruckend zeigen sich übrigens Wege, die von vielen kleinen Torii eingefasst sind. Sie führen zu Schreinen der Kami Inari, der Gottheit der Fruchtbarkeit, so beispielsweise zum Fushimi-Inari-Schrein in Kyoto, zum Taikodari-Inari-Schrein in der Präfektur Yamaguchi oder zum Motonosumi-Inari-Schrein, ebenfalls in der Präfektur Yamaguchi. Zwar ragen die kleinen Torii nicht so weit heraus wie ihre großen Verwandten. Aber beim Durchschreiten so vieler kleiner Torii hintereinander dürfte dennoch ebenfalls ein Gefühl der Andacht entstehen: Du betrittst heiligen Boden.
Für die Gottheiten vorgesorgt
Mit dem hölzernen Tor mitten im Nirgendwo meine ich selbstverständlich das Torii auf der Insel Miyajima, das wohl prominenteste Exemplar. Mich fasziniert der Gedanke, dass an dieser Stelle die profane Welt endet und ein spirituell aufgeladener Raum beginnt. Möglicherweise wispert dahinter die Natur mit viel mehr Ehrfurcht. Möglicherweise fallen kleinkarierte Sorgen von dem Menschen einfach ab, der ein solches Torii durchschreitet. Vielleicht passiert aber auch gar nichts.
Und trotzdem mag ich die Vorstellung, dass die Übergänge zwischen zwei Sphären mit solchen sehr schön anzuschauenden Symbolen markiert sind. Die Torii werden nie verschlossen und sie bilden wundervolle Wahrzeichen. Umso schöner zu wissen, dass es — um immer wieder Torii zu ersetzen oder neue errichten zu können — in Japan sogar Holzschutzgebiete gibt. 終